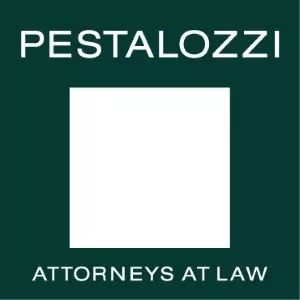- within Technology topic(s)
- in United States
- within Family and Matrimonial topic(s)
- with readers working within the Accounting & Consultancy industries
«On Artificial Intelligence, trust is a must, not a nice to have.»1
«La seule chose un peu triste dans cette chambre d'Eulalie était qu'on y entendait le soir, à cause de la proximité du viaduc, les hululements des trains. Mais comme je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées, ils ne m'épouvantaient pas comme auraient pu faire, à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée.»2
I. Einführung
1. Digitale Umgestaltung der Umwelt
1.1 Technologische Entwicklungslinien
Die Digitalisierung ist heute in aller Munde. Sie verkörpert die aktuelle Speerspitze des technischen Fortschritts der Informationsgesellschaft und einer Entwicklung, die vor Jahrzehnten mit der Kommerzialisierung und Verbreitung des Computers als Arbeitswerkzeug im Alltag ihren Ausgang genommen hat. Durch ihre Komplexität mögen die mit IT-Systemen verknüpften Haftungsfragen komplizierter zu lösen sein. Dennoch wird sich in aller Regel immer eine natürliche oder juristische Person identifizieren lassen, die für Schäden verantwortlich gemacht werden kann. Mit der Künstlichen Intelligenz (KI) tritt nun vermehrt ein neuartiges Element hinzu. KI soll nicht nur menschliche Fehler ausgleichen, sondern für Menschen nur schwer zu erfassende Zusammenhänge entdecken und nutzbar machen. Algorithmen des maschinellen Lernens sollen intelligenter und vor allem schneller und zuverlässiger sein als Menschen. Sie sind sogar in der Lage, sich ohne menschlichen Beistand selbst Dinge beizubringen. Von künstlicher Intelligenz getriebene Algorithmen scheinen sich zudem hervorragend zur Steuerung von Robotern zu eignen. Sogenannt humanoide Roboter könnten als Bauarbeiter, Lageristen, Pfleger oder Rezeptionisten der Menschen neue Kollegen am Arbeitsplatz werden.3 Spätestens dann werden sich Haftungsfragen einer neuen Art stellen.
Roboter sind keine Menschen.4 Roboter haften nicht. Nur Menschen haften, auch wenn sie in einer zukünftigen Arbeitswelt mit Robotern und anderen künstlichen Akteuren zusammen interagieren. Weniger drastisch als bei Robotern macht sich diese Vorstellung bei Algorithmen aus, die ja keine physische Präsenz haben. Doch sind auch bei ihnen Vermögensschäden – man denke nur an Robo-Advisor in der Vermögensverwaltung – nicht auszuschliessen. In diesen und anderen Fällen wird sich zweifellos die Frage stellen, ob am Ende wie gewohnt immer nur die Menschen haften oder ob es angezeigt sein wird, die Menschen teilweise von dieser Haftung zu entlasten.
«Big Data» ist eines von zahlreichen Schlagwörtern, die im Zusammenhang mit Digitalisierung und neuen Technologien regelmässig in der öffentlichen Diskussion erscheinen. Sprachlich bezeichnet der Begriff ursprünglich schlicht grosse Mengen von Daten, welche angesichts ihres Umfangs und ihrer Komplexität vom Menschen nicht mehr erfasst und verarbeitet werden können.5 In der Folge wird der Begriff «Big Data» aber gerne auch als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die diese Datenmengen verarbeiten und strukturieren und dadurch für einzelne Unternehmen oder gar die Gesellschaft als Ganzes nutzbar machen sollen. Statistik war eine bedeutsame Disziplin seit der Entwicklung des modernen, verwaltungstechnisch organisierten Staates. Mit zunehmender Technisierung und dem Aufkommen der Massengesellschaft gewannen Daten über alle möglichen und denkbaren Vorgänge in der Gesellschaft, betreffen sie Kennzahlen und Messwerte im wirtschaftlichen Umfeld oder Angaben über den Tagesablauf der Menschen, entscheidende und zentrale Bedeutung. Dies betrifft insbesondere Daten, die durch Messung oder Beobachtung gewonnen werden können. Die Tagespresse bezeichnet Daten denn auch gerne als das neue Öl des 21. Jahrhunderts.
Geht es um Daten, die einer natürlichen Person zugeordnet werden können, besteht auf internationaler Ebene weitgehend ein Konsens, dass jede Bearbeitung solcher Daten grundsätzlich die Privatsphäre der betroffenen Person und allenfalls weitere ihrer Grundrechte berührt und beeinträchtigen kann.6 Um die Privatsphäre wirksam zu schützen, sind hinreichende gesetzliche Regelungen zu schaffen, die notwendige Eingriffe rechtfertigen können. Dies ist Gegenstand des Datenschutzrechts als das Recht vom Schutz der Personendaten, die gewissermassen laufend als Nebenprodukt des alltäglichen Lebens entstehen.7
Der Schutz von Sachdaten ist demgegenüber deutlich weniger ausgebaut, sieht man einmal vom strafrechtlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen ab. Bei Sachdaten als eine Art «Rohstoff» für die digitale Wirtschaft liegt der Fokus des Gesetzgebers, wenn überhaupt, eher bei der freien Übertragbarkeit 8 , beim Abbau von Lokalisierungsvorschriften,9 oder bei wettbewerbsrechtlichen Überlegungen.10
Zu Big Data gehören aber auch neue digitale Techniken, über die mit Begriffen wie Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz (KI oder englisch «Artificial Intelligence» – AI11) oder Internet der Dinge («Internet of Things» (IoT)) kommuniziert wird. In ihrem Zusammenhang ist auch auf die «Distributed Ledger Technologie» (DLT) hinzuweisen. Diese digitalen Techniken sollen maximale Effizienzsteigerungen bewirken, Grösseneinsparungen erbringen und die Entwicklung neuartiger Dienste ermöglichen. Man verspricht sich von ihnen zahlreiche Vorteile, etwa in Bezug auf Agilität, Produktivität, Entwicklungstempo und Autonomie, so beispielsweise durch maschinelles Lernen.12 Dadurch hat Big Data das Potenzial für eine umfassende, ja umwälzende Umgestaltung grosser Teile der Gesellschaft zu sorgen, insbesondere des wirtschaftlichen Bereichs mit seinen vielfältigen Produktions- und Kommunikationsprozessen.
Solche Prozesse zeigen regelmässig Auswirkungen auf die reale Umwelt, d.h. die Lebenswelt des Menschen, die sie seit der Industrialisierung im 19. Jh. tiefgreifend umgestaltet haben.13 Eine Tagung zu den rechtlichen Fragestellungen der KI in der Schweiz identifizierte fünf zentrale Bereiche, in denen ihr Einsatz mit besonderen Herausforderungen verbunden ist: Transparenz, Privatsphäre, Diskriminierung, Manipulation und Haftung.14 Diese Themenliste ist exemplarisch. Transparenz und Privatsphäre wurden oben beim Datenschutz angesprochen. Diskriminierung und Manipulation sind ernsthafte und vielschichtige Probleme, die im Zusammenhang mit der KI international breit diskutiert werden.15 Diese Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit dem fünften Thema der Liste – mit der (ausservertraglichen) Haftung.16
Das Haftpflichtrecht, eines der ältesten Gebiete des Rechts überhaupt,17 fand erst in dieser Zeit seine noch heute gültigen Formen und Ausprägungen, nachdem die damalige moderne Technik mit ihren neuen Gefährdungen Gesetzgeber wie Rechtsanwender herausforderte.18 Heute stellt sich die offensichtliche Frage, ob die Digitalisierung zu weiteren, wesentlichen Entwicklungsschritten im Haftpflichtrecht führen muss oder ob die aktuellen Normen im Zuge der Rechtsfortbildung bloss nachgezogen werden können, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu bleiben. Anders formuliert lautet die Frage, ob und wie sich die traditionellen Muster der Verantwortlichkeit handelnder Akteure an die digital umgestalteten Prozesse anpassen lassen.
Das grundlegende Schädigungsschema des Haftpflichtrechts besteht aus einem Akteur (der potenziell Verantwortliche oder Schädiger), einer von ihm ausgeführten Handlung (Ursache) sowie einer durch diese Handlung ausgelösten Wirkung in der Umwelt (die zu einem Schaden führt). Ursache und Wirkung können jeweils in der analogen oder in der digitalen19 Umwelt angenommen werden, woraus sich insgesamt vier Fallgruppen bilden lassen.
To view the full article click here.
Footnotes
1. Margarethe Vestager, ehem. Executive Vice President of the European Commission for A Europe Fit for the Digital Age.
2. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Paris 2022 (Sonderausgabe), S. 1338.
3. Eine kurze geschichtliche Übersicht zur Entwicklung der Robotik mit Beispielen von Robotern findet sich bei Haddadin/Knobbe, in: Ebers/Heinze/Krügel/Steinrötter, Rechtshandbuch, § 1 Rz 26–34.
4. Der Begriff Roboter wird auf das 1920 erschienene Drama des tschechischen Schriftstellers Karel Čapek zurückgeführt, in dem es um Fronarbeit geht.
5. Vgl. Ebers, in: Ebers/Heinze/Krügel/Steinrötter, Rechtshandbuch, § 3 Rz 11, der dieses Problem als «Wissensvorsprung» der Maschine vor dem Nutzer umschreibt.
6. Botschaft DSG 2017, 6962.
7. Eine Liste der «Meilensteine der Datenschutz-Geschichte» findet sich auf der Webseite des BfDI (https://www.bfdi.bund.de/DE/DerBfDI/Inhalte/Datenschutzpfad/Geschich te-Datenschutz.html, zuletzt besucht am 07.08.2025).
8. Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO, Art. 28 DSG.
9. COM(2017) 495 final.
10 .COM(2020) 842 final. Im weiteren Zusammenhang erwähnenswert erscheint auch die Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen («Taxonomy Regulation»), die ein technisch robustes Klassifikationssystem auf Unionsebene einführen soll, um für die Belange der Finanzberichterstattung und der Kommunikation mit Finanzinvestoren Klarheit darüber zu schaffen, welche Tätigkeiten als «grün» oder «nachhaltig» gelten sollen.
11. Eine allgemeingültige Definition der KI existiere nicht, stellte der Bericht IDAG KI, S. 7 noch fest. Zwischenzeitlich siehe Art. 3(1) des Gesetzes über KI.
12. COM(2017) 495 final, S. 2.
13. Siehe dazu Osterhammel, S. 907 ff. zu Technik, Arbeit, Kommunikation, Verkehr u.a.
14. Graf/Obrecht, S. 2.
15. Wildhaber/Lohmann/Kaspar, S. 459.
16. Vgl. die Liste der KI-spezifischen Risiken bei ELI-Response, S. 9, welche den Themenbereich der sozialen Risiken wie Diskriminierung und Missbrauch umfasst.
17. Kaser, Privatrecht, S. 26, 146 ff.
18. Wesel, Fast alles was Recht ist, S. 126 ff., insb. S. 128 zum Reichshaftpflichtgesetz von 1871; ferner Wesel, Geschichte des Rechts, Rz 285, Harke, Römisches Recht, S. 206 ff. Nach Wildhaber, Haftung und KI, Rz 3 stellt sich diese Frage heute ganz konkret für die KI, so wie sie sich zuvor schon für die Gentechnologie u.ä. stellte.
19. Nach dem Duden steht das Adjektiv «digital» in Technik und Datenverarbeitung für «zahlenmässig, ziffernmässig; in Stufen erfolgend» und ist in der 2. Hälfte des 20. Jh.s. aus englisch digital übernommen worden.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.